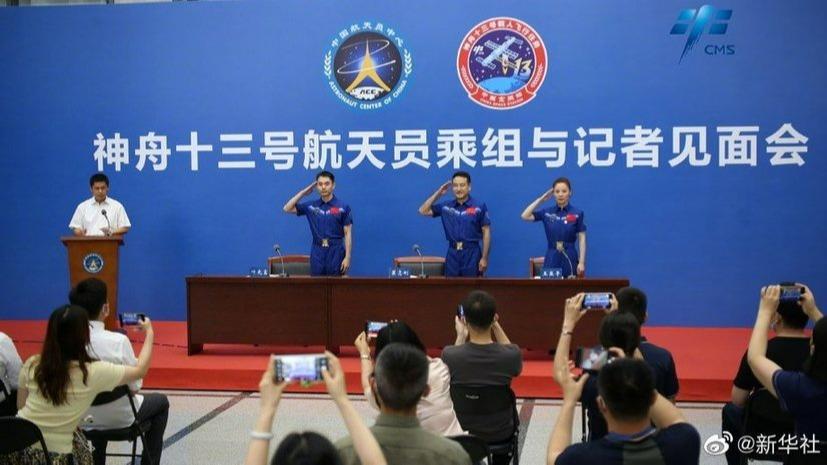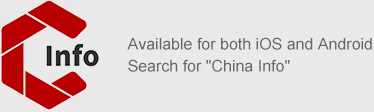Wenn die Vernunft über die (grüne) Emotion siegt...
Die Europäische Union hat bekannter Maßen zahlreiche Probleme. Eines der größten ist die täglich wiederkehrende Unsicherheit darüber, ob und wie man die Wünsche und Notwendigkeiten von 27 teils völlig unterschiedlich regierten und strukturierten Länder unter einen Hut bringen kann. Dazu gesellen sich immer wieder grobe weltanschauliche und parteipolitische Differenzen. All das führt regelmäßig zu erheblichen Schwierigkeiten in den EU-Beschlussfassungen. Wenn sich in diese Melange auch noch die Tatsache des gerade jetzt tobenden EU-Wahlkampfes mischt, wird es unangenehm und teilweise höchst emotional.
Jüngstes Beispiel aus dem EU-Alltag. Das von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als ihr persönliches „Herzensprojekt“ dargestellte und vor allem von den Grünen Parteien stark gepushte EU-Lieferkettengesetz.
Europäische Firmen, so lautete die Idee der Lieferkettenrichtlinie, müssten genau kontrollieren, ob ihre Geschäftspartner in anderen Teilen der Erde Menschenrechte einhalten und die Umwelt schützen. Und zwar über die gesamte Wertschöpfung hinweg, vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt.
Die Unternehmen in Europa sollten derart sicherstellen, dass es bei ihren Zulieferern keine Kinderarbeit und Ausbeutung gibt, dass keine Flüsse verschmutzt und keine Wälder abgeholzt werden. Eine kaum zu bewältigende Aufgabe, meinten viele und sollten Recht behalten.
Der Gesetzesantrag erhielt keine Mehrheit im EU-Parlament. Und das ist - so sehr manche darüber den Kopf schütteln mögen - auch besser für Europa und den Rest der Welt.
Vor allem aus zwei Gründen:
Erstens hätte kaum ein Konzern in der EU die Chance und auch gar nicht die Kapazitäten, entsprechend dem Gesetzesentwurf die Lieferketten zu überwachen. Wie soll beispielsweise eine Firma mit Sitz in München, Salzburg oder Budapest überprüfen können, ob irgendwo im Tschad ein 15-jähriges Mädchen (von dem man schon vorab unmöglich kontrollieren kann, ob es jetzt 13, 15 oder 17 Jahre alt ist) ausreichend lange Arbeitspausen bekommt und die im Arbeitsprozess angehäuften Abfälle in die gelbe oder in die grüne Mülltonne geworfen werden?
Zweitens - und das wiegt in Kenntnis der wirtschaftspolitischen, gesellschafts- und sozialpolitischen Realität innerhalb Europas noch viel schwerer - hätte die Implementierung ebendieses Gesetzes der weltanschaulich motivierten politischen Willkür Tür und Tor geöffnet. Es ist bekannt, dass sich in der EU eine Vielzahl von politischen Entscheidungsträgern tummelt, die ihre ganz persönliche und teils recht wirr-grüne Lebensphilosophie am liebsten der ganzen Welt überstülpen würden. Die der Meinung sind, dass all jene mit größtmöglicher Härte zu bekämpfen und zu bestrafen sind, die in ein Auto oder gar in ein Flugzeug einsteigen. Dass die Lebensqualität von Regenwürmern, Fröschen und Ratten nie und nimmer beeinträchtigt werden darf durch menschliches Leben und durch den globalen Handel. Dass dann freilich genau jene Entscheidungsträger, die sich in diesem Zusammenhang besonders offensiv verhalten (schlag nach bei Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock oder Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler) selbst verdächtig oft nicht nur mit Flugzeugen, sondern auch in Privatjets die Welt mehrmals umrunden, sei an dieser Stelle auch noch erwähnt.
Manche Politiker in der EU mögen das (wohl letztgültige) Scheitern des Lieferkettengesetzes als große Niederlage einstufen. In Wahrheit war es ein Sieg. Ein Sieg der Vernunft und ein Sieg der Weltwirtschaft.

MARTIN SÖRÖS, FREIER JOURNALIST AUS ÖSTERREICH